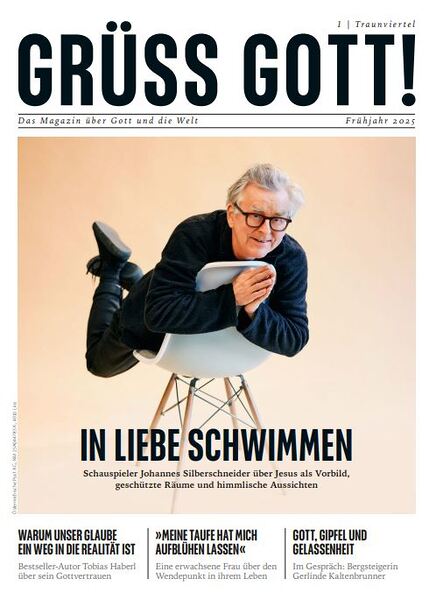Frankenburg: Ein ganzer Ort im Würfelspielfieber
Am Freitag, 25. Juli, findet die Premiere der heurigen Spielsaison des „Frankenburger Würfelspiels" statt. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Schauspiels gibt es bis 17. August auf der örtlichen Freiluftbühne insgesamt zwölf Aufführungen. Am Sonntag, 27. Juli, findet um 10 Uhr auf dem Würfelspielgelände ein ökumenischer Gottesdienst statt, dem u. a. Diözesanbischof Bischof Manfred Scheuer und Superintendent Gerold Lehner vorstehen werden.
Das „Würfelspiel" wird seit genau 100 Jahren aufgeführt und erinnert an das Blutgericht auf dem Haushamerfeld vor exakt 400 Jahren. Die Österreichische Post hat dazu eine Sondermarke zu „400 Jahre Blutgericht auf dem Haushamerfeld" aufgelegt, in Frankenburg wurde zudem das neue Opferdenkmal „Seid wachsam" der örtlichen Künstlerin Maria Moser aufgestellt.
Historischer Hintergrund
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war ein Großteil der Bevölkerung Oberösterreichs evangelisch, sehr zum Missfallen der katholischen Habsburger. Diese bemühten sich über Jahrzehnte, eine Rekatholisierung des Landes durchzuführen. Schon in den 1590er-Jahren kam es zu kleineren Schlachten der Bauern gegen den Adel. Der Krieg endete mit einer schmerzlichen Niederlage der Bauern. Doch der Konflikt schwelte weiter.
Neben einem Religionskonflikt spielten freilich immer auch soziale Fragen mit hinein. Immer mehr Bauern rutschten damals in die Armut ab. Die Preise für ihre Produkte wurden immer schlechter, zugleich wurde die Last, die die Adeligen den Bauern auferlegten, immer höher.
Eine explosive Mischung: Als im Mai 1625 in Frankenburg ein römisch-katholischer Geistlicher eingesetzt werden sollte, kam es zum Aufstand der evangelischen Bevölkerung. Diese Rebellion wurde jedoch nach wenigen Tagen wieder aufgegeben, da der (katholische) Statthalter Adam Graf von Herberstorff vermeintliche „Gnade" versprach, falls die Aufständischen „ohne Wehr und Waffen" am 15. Mai zum Haushamerfeld kämen. Rund 5.000 Bauern aus der Umgebung folgten dem Aufruf.
Statt der vermuteten Gnade für die Aufständischen wurden 36 führende Vertreter des Bauernstandes festgenommen. Der Statthalter ließ sie paarweise um ihr Leben würfeln. 16 der „Verlierer" und eine weitere Person wurden anschließend gehängt.
Herberstorff verfügte zudem, dass die gesamte Bevölkerung bis Ostern 1626 wieder zur Katholischen Kirche übertreten müsse. Evangelische Gottesdienste waren offiziell schon längst verboten, evangelische Geistliche und Lehrer des Landes verwiesen, auch wenn viele dem vorerst nicht Folge leisteten. (Erst 1628 gingen die letzten.) Im Mai 1626 brach in Oberösterreich der große Bauernaufstand aus.
Museum im Frankenburger Würfelspielhaus
Wer sich für die Hintergründe des Schauspiels interessiert, ist im Frankenburger Würfelspielhaus nahe der Freilichtbühne richtig. Im Erdgeschoss wurde ein Museum eingerichtet, mit vielen interessanten Stationen. Das Museum besteht seit 2004, es wartet aktuell mit zahlreichen neuen Attraktionen auf, die vor allem ein junges Publikum ansprechen sollen. So gibt es etwa 3D-Animationen und ein Escape-Room-Abenteuer im Obergeschoss. Erst Mitte Mai wurde alles fertiggestellt, ab Herbst hofft Michael Neudorfer, der Obmann des dafür verantwortlichen Vereins, auf viele Schülergruppen. Er führte im Rahmen einer von Kathpress und dem evangelischen Pressedienst veranstalteten Pressereise unlängst durch das Museum.
Ein Prunkstück des Museums sind drei ausgestellte Würfel. „Wir dachten lange, dass es sich um die Original-Würfel handelt", sagte Neudorfer. Dem ist aber doch nicht so, muss er einräumen. „Aber Experten haben uns versichert, dass die Würfel zumindest aus der passenden Zeit des Dreißigjährigen Kriegs stammen." Einer der Würfel ist übrigens gezinkt.
Das Laienschauspiel in Frankenburg schweißt den Ort zusammen. 400 Leute spielen mit, nochmals so viele sind anderwärtig beteiligt, erzählte Neudorfer: „Wenn es um das Würfelspiel geht, werden auch Grenzen überwunden, sogar politische Grenzen, die sonst den Alltag mitbestimmen."
Viele Überarbeitungen des Würfelspiels
Zum 300-Jahr-Gedenken wurde das „Frankenburger Würfelspiel" erstmals aufgeführt. Als Schauspiel verfasst wurde es vom oö. Schriftsteller Karl Itzinger. Der schon von Itzinger reichlich deutsch-national gefärbte Text wurde von den Nationalsozialisten nochmals ordentlich zugespitzt, so die frühere evangelische Oberkirchenrätin Hannelore Reiner, die auch im Frankenburger Team engagiert ist. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt es als NS-Stück und wurde wieder umgeschrieben. Unter anderem wurden antikatholische Stellen entfernt, das Schauspiel wurde auch immer mehr zu einem Stück über einen sozialen Aufstand. Später wurde der Kirchen- und Glaubenskonflikt wieder stärker aufgenommen, an anderen Stellen wurde auch den Frauen mehr Aufmerksamkeit zuteil, erläuterte Reiner. Seit 1999 gibt es rund um die jeweilige Spielzeit einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, den Hannelore Reiner maßgeblich mitprägte und prägt.
Seit 2019 hört das Stück auch nicht mehr mit dem Tod der Bauern auf, sondern beleuchtet auch die Zeit danach, als viele Bauern, die ihren evangelischen Glauben nicht aufgeben wollten, die Heimat verließen. Das Perfideste dabei: „Alle Kinder bis 12 Jahren mussten sie zurücklassen. Der Kaiser brauchte schließlich arbeitsfähige Untertanen", berichtete Obmann Neudorfer. Trotzdem zogen viele Bauern weg und fanden u. a. in Franken in Deutschland eine neue Heimat. Auch dieser historischen Episode ist ein Teil der Ausstellung im Museum in Frankenburg gewidmet. Obmann Neudorfer konnte zudem davon berichten, dass es jetzt wieder gute Beziehungen und Freundschaften zwischen den Frankenburgern und den Nachkommen der Ausgewanderten gibt.
Einsatz für Menschenrechte
Der evangelische Bischof Michael Chalupka betonte beim Besuch in Frankenburg und am Haushamerfeld, dass es beim Gedenken an das Blutgericht nicht um eine Art „evangelische Vereinsgeschichte" geht. „Was vor 400 Jahren in Oberösterreich passierte, geht das ganze Land an." Alle Österreicherinnen und Österreicher hätten daraus ihre Lehren zu ziehen, so Chalupka.
Würfelspiel-Obmann Neudorfer formulierte es so: „Es geht um eine lebendige Erinnerungskultur. Es geht uns darum, das Bewusstsein für Tendenzen zu schärfen, die unsere demokratische Gesellschaftsordnung und unsere Werte, ja die Menschenrechte an sich auf's Spiel setzen." Daher verkündet Richter Christoph Stratter – einer der Hingerichteten – am Ende des Stücks: „Im Gedenken an alle, die gestern und heute an Intoleranz und Ungerechtigkeit litten und noch immer leiden."
(Infos: https://www.wuerfelspiel.at/)